Thomas Angeli ist Co-Präsident von Lobbywatch.ch, einer Datenbank, die Interessenbindungen von Parlamentariern zu Firmen, Vereinigungen und Institutionen aufzeigt. Im Interview mit Nachbern.ch spricht Angeli über das Lobbying in den parlamentarischen Gruppen, die Transparenz des Parlaments und erzählt, wie Lobbys mit ihren Anliegen in die Medien kommen.
Nach dem Interview mit CVP-Nationalrat Urs Schläfli hatte ich den Eindruck, er rede lieber mit Lobbyisten als mit Journalisten. Ist das gefährlich?
Man muss als Politiker nicht unbedingt mit Journalisten reden. Wer aber eine allzu grosse Nähe zu Lobbyisten hat, begibt sich in die Gefahr, abhängig zu werden und nur noch die Meinungen gewisser Interessengruppen zu hören. Es legen zudem nicht alle Lobbyisten ihre Interessen offen.
Müssten die Badges abgeschafft werden?
Nicht zwingend, aber es muss Transparenz geschaffen werden. Heute kann ein Parlamentarier ja einer Person einfach als «Gast» Zugang zum Bundeshaus gewähren – und niemand hat eine Ahnung, welche Interessen dieser Gast vertritt. Wir von Lobbywatch.ch recherchieren diese Fragen, deren Transparenz eigentlich Aufgabe des Staates sein müsste, zum Beispiel der Parlamentsdienste. Die Parlamentsdienste können aber von sich aus gar nicht aktiv werden, dazu braucht es zunächst mal den politischen Willen des Parlaments, und der ist bisher nicht vorhanden. Im Nachgang der Kasachstan-Affäre wurden diesbezüglich parlamentarische Vorstösse lanciert, aber die werden erst nach den Wahlen behandelt. Was davon umgesetzt wird, zeigt die Zukunft. Wir sind sehr beschränkt optimistisch.
Ich hatte den Eindruck, die Parlamentsdienste verstehen sich nicht als Dienst am Bürger, sondern am Parlamentarier.
Es geht schon aus dem Namen hervor: Die Parlamentsdienste sind für das Parlament da. Es ist ein Dienstleistungsunternehmen innerhalb des Parlaments, das nicht stark auf eine Aussenwirkung ausgerichtet ist. Immerhin ist die Transparenz gegen aussen in den letzten Jahren etwas besser geworden. Die Liste der Zutrittsberechtigten ist inzwischen wenigstens im PDF-Format [Nationalrat / Ständerat] auf Parlament.ch verfügbar. Vor wenigen Jahren noch war diese Liste nur auf Anfrage in einem Büro der Parlamentsdienste einsehbar. Journalisten mussten diese Namen von Hand abtippen.
Wieso braucht es Lobbywatch.ch überhaupt?
Otto Hostettler und ich haben bei unserer journalistischen Tätigkeit für den «Beobachter» nicht nur eine grosse Intransparenz festgestellt, sondern auch, dass viele der aufgeführten Mandate und Interessenbindungen nicht mehr aktuell sind oder schlicht vergessen wurden. Niemand kontrolliert diese Liste, und es gibt keinerlei Sanktionen, wenn etwas nicht stimmt. Wir wollten deshalb eine Datenbank zur Verfügung stellen, die für alle abrufbar und recherchierbar ist.
Wie finanziert sich Lobbywatch.ch?
Wir haben im Herbst 2014 mit einem Crowdfunding 13 800 Franken gesammelt. Wenn wir die Daten vervollständigen und aktuell halten wollen, werden wir in der nächsten Zeit ein weiteres Crowdfunding machen müssen, denn nur mit Freiwilligenarbeit ist das nicht zu stemmen. Wir werden deshalb junge Journalisten anstellen, die für uns diese Recherchen machen.
Wer sind die problematischsten Lobbyisten?
Die Netzwerke im Parlament, die in den Bereichen Pharma oder Krankenkassen gesponnen werden, sind sehr stark. Ebenfalls stark, aber von uns noch nicht erschöpfend untersucht, ist die Landwirtschaftslobby. Die Lobby der Energieversorger dagegen hat gegenüber früher etwas an Einfluss verloren. Lobbyisten holen gerne Parlamentarier in Verwaltungsräte, um Einfluss auszuüben oder bemühen sich um einen der 492 Badges. Ein anderer, immer wichtiger werdender Bereich sind die parlamentarischen Gruppen, die Interessensgemeinschaften, die im Parlament gegründet werden. Das ist ein bisher völlig unkontrollierter Bereich des Lobbyings, in dem wir Transparenz schaffen wollen. Diese Gruppen sind in einer PDF-Datei auf Parlament.ch einsehbar. Interessant ist jeweils, wer das Sekretariat dieser Gruppen führt: oft erledigen das Interessenverbände oder Lobbyfirmen. Hier werden die Bewegungen der Parlamentarier orchestriert.
Wie kommen Lobbyisten in die Medien?
Die einfachste Form ist vermutlich, eine Studie zu machen. Wenn die Botschaft sexy ist, dann reicht es den Journalisten oft schon, wenn die Studie einen halbwegs seriösen Eindruck macht, und schon berichten sie breit. Das ist eine Form des Lobbying.
Haben es Lobbyisten nicht furchtbar leicht, auf die Titelseiten von Medien kommen, in dem sie Informationen bei Journalisten platzieren?
Ja. Aber man muss auch sehen, dass der Zeitdruck, den Journalisten heute haben, immens ist. Das Hauptbedürfnis vieler Journalisten ist es daher, möglichst schnell zu Informationen zu kommen. Und wenn man schnell sein muss, dann kann man nicht mehr in die Tiefe gehen und ist unter Umständen froh, wenn man eine Geschichte auf dem Silbertablett serviert erhält.
Was sagen Sie zu Parlamentariern wie Lorenz Hess (BDP), die hauptberuflich Lobbyisten sind?
Neu ist das nicht, und aus der Logik eines Lobby-Unternehmens macht das durchaus Sinn. Mit Kandidaten wie Lorenz Hess (BDP) und Claudine Esseiva (FDP) perfektioniert das Furrerhugi nun. Auch Alexandra Thalhammer (FDP) von Burson-Marsteller kandidiert. Tatsächlich kann man kaum einen besseren Zugang zum Bundeshaus erhalten als durch einen eigenen Parlamentarier. Zudem gibt es auch immer mehr Parlamentarier mit eigenen Beratungsunternehmen: Sebastian Frehner (SVP), Albert Rösti (SVP) oder Gregor Rutz (SVP), um nur einige zu nennen. Das sind Personen, die Vollzeit in einer Mischform zwischen Parlamentarier, Kommunikationsarbeiter und Lobbyist unterwegs sind.
Wie geht es nun weiter mit Lobbywatch.ch?
Wir wollen zunächst unsere Datensammlung vervollständigen. Sobald das gemacht ist, können wir diese Daten visualisieren. Vielleicht können wir uns dann auch besser vernetzen mit anderen Projekten. Gerade auf europäischer Ebene gibt es sehr interessante Projekte, die sich dem Lobbying widmen: Lobbycontrol.de, Abgeordnetenwatch.de oder Lobbyplag.eu. Um das alles umzusetzen, brauchen wir aber mehr Mitglieder, bisher ist die Mitgliederzahl überschaubar.
Das Gespräch mit Thomas Angeli wurde am 9. Oktober 2015 in Zürich geführt.











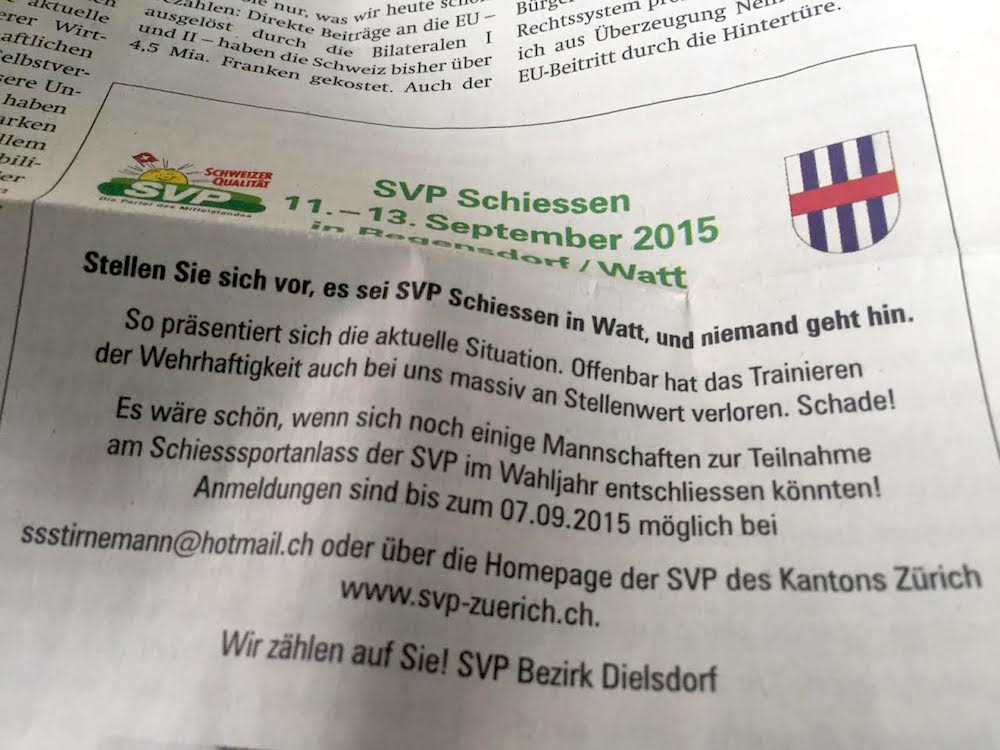






Letzte Kommentare